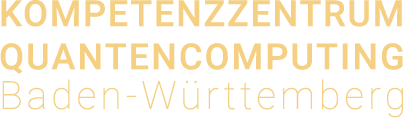Konsortium
Das Fraunhofer IAF ist neben dem IAO für die Koordination des KQCBW zuständig. Die Grupp Quanteninformation unter Leitung von Thomas Wellens beschäftigt sich mit Themen an der Schnittstelle von Quantenhardware und -software, insbesondere Fehlercharakterisierung, Fehlermitigation und Quantenoptimierung.
Die Gruppe Quantum Systems Engineering von Rebekka Eberle entwickelt integrierte Farbzentren-basierte Quantencomputing-Systeme und transferiert Protokolle zur NV-Kopplung in die Anwendung. Hierfür wird an der HPC-Anbindung der Messsysteme zur Durchführung von hybriden Quantenalgorithmen auf NV-Zentren in Diamant im Quantencomputing-Labor am Fraunhofer IAF gearbeitet.
Kontakt: Dr. Thomas Wellens
Website: Quantencomputing – Fraunhofer IAF
Gemeinsam mit dem Fraunhofer IAF koordiniert das Fraunhofer IAO das KQCBW und führt dessen dediziertes Ausbildungsprogramm wiederkehrend durch. 2021 wurde am Fraunhofer IAO das dedizierte Team „Quantencomputing“ im Forschungsbereich „Digital Business“ gegründet.
Im Rahmen der anwendungsorientierten Forschungsprojekte „SEQUOIA“, „SEQUOIA Ent-to-End“, „AutoQML“, „QORA II“ und mehrerer vertraulicher Industrieprojekte hat das Fraunhofer IAO umfangreiche Expertise in der End-to-End-Umsetzung und Demonstration heutiger industrieller Anwendungsfälle auf verschiedener Quantenhardware erworben. Der technische Schwerpunkt des Teams liegt dabei auf Algorithmen, die auf gatterbasierter QC-Hardware sowie auf Quantenannealern implementiert werden (u.a. QAOA[+], VQE, VQR, QNNs, QSVMs und Circuit Learning Methods).
Kontakt: Dr. Vamshi Mohan Katukuri
Website: Quantencomputing – Fraunhofer IAO
Das Fraunhofer IPA hat zu Beginn des Jahres 2022 die Gruppe Quantencomputing mit den Schwerpunkten quantenmaschinelles Lernen, Quantenoptimierung und Quantensimulation gegründet. Die Gruppe kann durch die erfolgreiche Beteiligung in den Projekten SEQUOIA, SEQUOIA End-to-End, AutoQML und AQUAS sowie im Rahmen laufender Projekte (KQCBW24 und H2Giga) breitgefächerte und tiefgreifende Expertise in den oben genannten Bereichen nachweisen. Im Projekt AQUAS konnte bereits gezeigt werden, dass das Lernen basierend auf Informationen der quantenmechanischen Wellenfunktion zu einem dateneffizienten QML-Modell zur Vorhersage molekularer
Anregungsenergien und Übergangsdipolmomente führt. Im Rahmen des Projekts H2Giga wurden verschiedene VQE-Algorithmen und Methoden des Fermion-Qubit-Mappings in einer gemeinsamen Programmbibliothek implementiert und deren Performance für verschiedene Systeme umfassend untersucht. Weiterhin konnten hier bereits einige Erfahrungen mit verschiedenen Varianten des „classical shadow“-Algorithmus gesammelt werden. Im KQCBW Transferprojekt wurden außerdem bereits Erfahrungen mit early-fault-tolerant-Algorithmen wie QCELS gemacht.
Kontakt: Dr. Marco Roth
Website: Quantencomputing – Fraunhofer IPA
Das Fraunhofer IWM befasst sich seit vielen Jahren mit atomistischen Computersimulationen von chemischen und physikalischen Eigenschaften von metallischen und keramischen Werkstoffen für Systeme zur Energiespeicherung (Lithiumionenbatterien) und Energieumwandlung (Brennstoff-/Elektrolyse-Zellen). Seit 2021 befasst sich das Fraunhofer IWM intensiv mit der Herausforderung, das Quantencomputing zur schnelleren und präziseren Simulation bestimmter Materialklassen anzuwenden. In den Projekten QuESt und QuESt+ standen einerseits die Verlagerung des numerisch anspruchsvollsten Teils der DMFT-Rechnungen auf den QC und ander-erseits die Berechnung von Energiespektren von Defektkomplexen mit variationellen Algorithmen sowie Fehlermitigation im Mittelpunkt der Forschungsarbeit. Im Rahmen der in 2024 gestarteten Projekte KQCBW24 und QUBE wurden außerdem erste Erfahrungen mit der Simulation der Zeitentwicklung von Spin-Systemen sowie fermionischen Quantensystemen im Rahmen des DMFT Frameworks gewonnen.
Kontakt: Dr. Daniel Urban
Website: Quantencomputer für innovative Materialsimulation nutzen – Fraunhofer IWM
Das Fraunhofer ICT forscht und entwickelt in den Kernkompetenzen Chemische Prozesse, Kunst-stofftechnologie, Energie und Antriebe sowie Explosivstofftechnik und Sicherheit. Hierbei dienen seit mehreren Jahren die Ergebnisse und Analysen der molekularen Simulation unter Verwendung von quantenmechanischen und molekulardynamischen Berechnungen der Unterstützung experimenteller Arbeiten. Seit 2021 liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Integration und Nutzung des Quantencomputing. Im Rahmen der Projekte QC-4-BW I und II sowie KQCBW24 hat das Fraunhofer ICT seine Expertise im Bereich der Quantenchemie und Materialforschung erfolgreich genutzt und das Softwarepaket qc-on-qc (Quantenchemie auf Quantencomputern) entwickelt, welches die Berechnung größerer Molekülsysteme, insbesondere metallorganischer Gerüstmaterialien (MOFs), mit stark korrelierten Elektronensystem auf Quantencomputern ermöglicht. Im Rahmen der bisherigen Projektarbeit wurden zudem zwei Publikationen im Bereich variationeller Algorithmen zur Verbesserung der
Ansätze für Schaltkreise erstellt, die sich derzeit im Peer-Review-Prozess befinden.
Kontakt: Dr. Andreas Omlor
Website: Chemische Prozesse – Fraunhofer ICT
Die Gruppe Theorie elektrochemischer Systeme des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik unter Leitung von Prof. Dr. Birger Horstmann arbeitet an der Modellierung von Batterien. Dabei liegt der Fokus auf der Entwicklung von Quantenalgorithmen für die elektronische Struktur und die Simulation quantendynamischer Prozesse auf Quantencomputern, um relevante Prozesse an elektrochemischen Grenzflächen und in Batteriezellen besser zu verstehen. So wird das Management von Lithium-Ionen-Batterien verbessert und neuartige Batterien optimiert.
Kontakt: Prof. Dr. Birger Horstmann
Website: Theorie Elektrochemischer Materialien – Helmholtz-Institut Ulm
PD Dr. Sabine Wölk und ihre Gruppe am DLR-Institut für Quantentechnologien in Ulm verfügen über Expertise im Bereich der Entwicklung und Implementierung verschiedener Quantenalgorithmen, unter anderem mit den Schwerpunkten Hardware-Software-Codesign und Quantum-Reinforement-Learning. In den Projekten QuESt und QuESt+ wurden zusammen mit den Projektpartnern umfangreiche Erfahrungen im Bereich NISQ-Algorithmen für die Quantensimulation
gemacht, wobei die Themen Error Mitigation und klassische Simulationsmethoden im Vordergrund standen. Aufbauend darauf wurde im KQCBW-Transferprojekt dann ein iterativer, klassischer Algorithmus zum Finden von effizienten Schaltkreisen für die näherungsweise Präparation von SOS-Anfangszuständen entwickelt und die entsprechenden Circuits für (frühe-) fehlertolerante Plattformen optimiert.
Kontakt: PD Dr. Sabine Wölk
Website: Abteilung Quanteninformation und -kommunikation
Die Gruppe von Prof. Dr. Jörg Wrachtrup am 3. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart (USTUTT-3PI) leistet seit mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit bei der Entwicklung und Kon-trolle von Spin-Defekten in Festkörpermaterialien für Quantenanwendungen. Das USTUTT-3PI hat die langlebigen Kernspin-Qubits in Diamant und Siliziumkarbid für die Demonstration von universellen Quantengattern und Quantenalgorithmen nutzbar gemacht. Das USTUTT-3PI verfügt über Einrichtungen zur Erzeugung von Quantenbits und zur Nanostrukturierung von photonischen Quantengeräten. Sie befassen sich mit der Skalierung dieser Systeme und der Implementierung von Quantenalgorithmen wie der Quanten-Fourier-Transformation oder der Quantenfehlerkorrektur in skalierbarer Weise. Das Institut leistet einen Beitrag zum Test skalierbare Spin-Qubit-Register mit bis zu 20 Qubits sowie zur Demonstration fehlerfreier logischer Qubits und ihrer universellen logischen Operationen.
Kontakt: Prof. Dr. Jörg Wrachtrup
Website: 3. Physikalisches Institut | University of Stuttgart
Am 5. Physikalischen Institut wird seit 20 Jahren an Rydbergatomen geforscht. Prof. Dr.Tilman Pfau ist auch Gründungsdirektor des Quantenzentrums (Stuttgart/Ulm) IQST sowie Initiator und Koordinator des DFG Schwerpunkts SPP1929 GiRyd. Tilman Pfau und Florian Meinert arbeiten seit vier Jahren am Aufbau von Quantencomputerhardware basierend auf neutralen Strontium Atomen in optischen Tweezer arrays, die im Moment zu einer patentierten Quantencomputer-Plattform mit bis zu 400 dynamisch verschiebbaren Qubits ausgebaut wird. Auf dieser Plattform wurde erstmals das Feinstruktur-Qubit in Strontium demonstriert und patentiert. In Kooperation mit Prof. Hanspeter Büchler wurde auch ein Web-Access vorbereitet, mit dem bereits ein Emulator mit bis zu 30 Qubits programmiert werden kann.
Kontakt: Prof. Dr. Tilman Pfau
Website: 5. Physikalisches Institut | Universität Stuttgart
Das Quantencomputing-Team am IAT besteht aus fünf Personen, die sich mit Aktivitäten wie der Erforschung von Quantenalgorithmen für partielle Differentialgleichungen, Schaltungsoptimierung, der Entwicklung von Frameworks für Quanten-Maschinelles Lernen, Schulungsprogrammen und Wissenstransfer befassen.
Kontakt: Niclas Schillo
Website: Forschung – flaQship
Die Forschungsgruppe von Prof. Fedor Jelezko demonstrierte Anwendungen von NV-Spin-Qubits in Diamant für Quantencomputing und Quantensimulation, insbesondere die kohärente Kopplung zwischen NV-Farbzentren und Kernspins und optimale Quantenkontrolle eines Diamant-Spin-Quantenregisters.
Kontakt: Prof. Fedor Jelezko
Website: Institut für Quantenoptik – Universität Ulm
Das Kernthema des Instituts für komplexe Quantensysteme unter der Leitung von Prof. Joachim Ankerhold ist die Forschung an mikro- und mesoskopischen Systemen. Insbesondere arbeitet das Institut an Möglichkeiten der Kontrolle und der Anwendung der Letzteren für den Bereich der Quantentechnologien. Dabei kann das Institut auf anspruchsvolle Simulationsmethoden für die Dynamik offener Quantensysteme zurückgreifen. Des Weiteren wurden kürzlich Methoden der Fehlermitigation für Quantentechnologien entwickelt.
Kontakt: Prof. Joachim Ankerhold
Website: Welcome – Universität Ulm
Prof. Guido Burkard erforscht als theoretischer Physiker das Quantenrechnen in Festkörpersystemen, insb. mit Spins in Halbleitern sowie mit supraleitenden Schaltungen und mit hybriden Quantensystemen bestehend aus halbleitenden und supraleitenden Teilen. Seine Arbeiten befassen sich außerdem mit den theoretischen Grundlagen von Dekohärenz in Quantensystemen und deren Auswirkungen auf Quantenrechner, sowie mit dem fehlertoleranten Quantenrechnen.
Kontakt: Prof. Guido Burkard
Website: Burkard Group – Condensed matter theory and quantum information
Schwerpunkte der Arbeit von Prof. Daniel Braun liegen im Bereich offener Quantensysteme und Dekohärenz, der Quantenmetrologie und der Quantifizierung relevanter Quantenressourcen. Jüngste Arbeiten drehen sich um den Einsatz maschinellen Lernens in der Quantenmetrologie und der möglichst effizienten Charakterisierung von Quantenkanälen.
Kontakt: Prof. Daniel Braun
Website: AG Braun | Universität Tübingen
Das FZI beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Entwurf und Qualitätssicherung von Softwarearchitekturen. Dazu zählen die Modellierung komponentenbasierter Softwaresysteme mit dem Palladio-Ansatz und domänenspezifische Modellierungsmethoden sowie die zugehörigen Analysen zur Bewertung und Vorhersage von Qualitätseigenschaften wie Performance und Zuverlässigkeit. Im Bereich Quantum Software Engineering, forscht das FZI an der Integration von Lösungen des QC in etablierte Softwareentwicklungsprozesse und der Werkzeugunterstützung für Quantencomputing.
Kontakt: Oliver Dennninger
Website: Software Engineering – FZI Forschungszentrum Informatik
Prof. Dr. Gerhard Hellstern ist theoretischer Physiker mit 20 Jahren Erfahrung im Bankenbereich, insbesondere Quantitative Finance, Risikomodellierung und angewandte Machine-Learning-Verfahren. Seit seiner Berufung an die DHBW 2018 beforscht er die Schnittstelle zwischen innovativen Technologien und ihrer Umsetzung im Finanzwesen und dabei insbesondere das Quantencomputing.
Prof. Dr. Martin Zaefferer lehrt im Bereich Data Science. Insbesondere beschäftigt er sich mit der modellbasierten Optimierung für kombinatorische Probleme, sowie dem Benchmarking von Optimierungsalgorithmen. Beide haben bereits in der ersten Phase des KQCBW-Projekts in QORA und QORA II die Schnittstelle zu Anwendungen bzw. zu klassischen Methoden abgedeckt. Im Rahmen des bisherigen KQCBW waren sie an folgenden Publikationen beteiligt.
Kontakt: Prof. Dr. Gerhard Hellstern
Website: Prof. Dr. Gerhard Hellstern | Verstärkung für den Bereich Data Science | DHBW Ravensburg
Assoziierte Partner
- Böhringer-Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
- EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- HQS Quantum Simulations GmbH
- IQM Germany GmbH
- Kipu Quantum
- Pfizer Pharma GmbH
- QC Design GmbH
- Quantistry GmbH
- Robert Bosch GmbH
- Tensor AI Solutions GmbH
- TOPTICA Photonics SE
- XeedQ GmbH